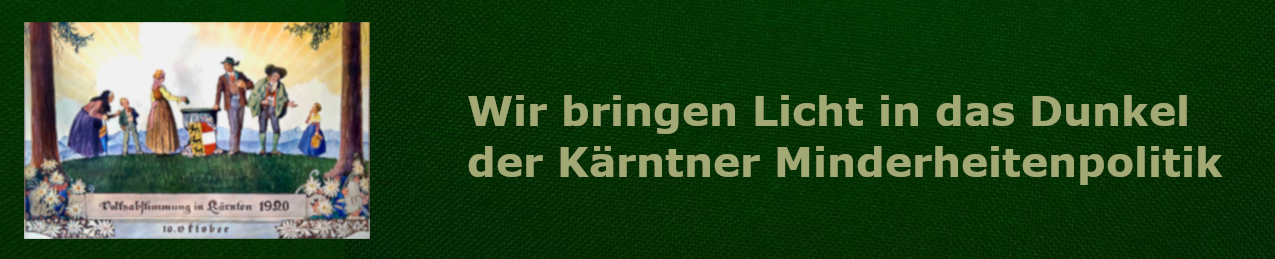Info Nr. 86
29.5.2025 Liescha/Leše (Slowenien) – Gedenken an die von Partisanen in den Maitagen 1945 verschleppten und ermordeten Zivilpersonen. Im Wald wurde der Opfer gedacht.
In Kärnten werden im Rahmen des Gedenkjahres 2025 die Opfer der Partisanen weiterhin verheimlicht.
1. Versöhnung und Verzeihung…
– Von den rund 700 im Wald (in Leše) vergrabenen Opfern stammen mehr als 90 aus Kärnten.
Der KHD und das Österreichische Schwarze Kreuz luden zum Opfergedenken ein. Zelebriert wurde die heilige Messe von Dechant Ivan Olip. Nach den Nachkommen der Opfer sprachen Landtagspräsident Reinhart Rohr, der österreichische Botschafter in Laibach Konrad Bühler, Josip Stjepandic, Präsident der kroatischen HAZUDD, sowie KHD-Obmann Andreas Mölzer Worte des Erinnerns.1
Die Gedenkveranstaltung stand im Zeichen von Versöhnung und Verzeihung. Insbesondere der Priester stellte diese Werte in den Mittelpunkt seiner Predigt. Dabei rief er aber auch die Verbrechen der kommunistischen Revolution und der Mörder unmissverständlich in Erinnerung.
Othmar Mory (ehemaliger Bürgermeister von Bleiburg) zählt zu den Initiatoren der Gedenkfeier in Liescha/Leše in Slowenien. Seit 1991 findet diese Feier im Gedenken an die verschleppten Kärntner Nachkriegsopfer am jeweiligen Christi-Himmelfahrts-Tag statt. Mory konnte ein vertrauensvolles Einvernehmen mit einheimischen Slowenen herstellen. Den Grundsatz „Vergeben – doch nicht vergessen“ wollte der Friedensstifter Othmar Mory, der selbst seine Eltern in Liescha/Leše, an der „Stätte des Grauens und des Gedenkens“, im Jahre 1945 verloren hat, an die jüngere Generation weitergeben. Mory hat einer grenzüberschreitenden Versöhnungskultur den Weg bereitet.2
Auch nach Morys Tod blieb Liescha-Leše ein Ort des Vergebens und Gedenkens mit Vorbildwirkung.
Es war natürlich zu erwarten, dass im Rahmen des Gedenkjahres 2025 die Friedensbotschaft von Liescha/Leše die Erinnerungskultur prägen wird. Das ist bedauerlicherweise ausgeblieben.
– In diesem Sinne wurde am 24.5.2025 in Viktring eine Gedenkmesse für die im Mai 1945 vor den Tito-Partisanen nach Kärnten geflüchteten Slowenen gefeiert: Die Welt feierte vor 80 Jahren das Kriegsende. Für viele Sloweninnen und Slowenen brachte dieses Kriegsende aber keinen Frieden und kein Glück. Die internationale Politik ermöglichte es den Kommunisten, das slowenische Volk zu beherrschen. Viele katholische Politiker, Priester, Intellektuelle, Domobranzen und Gegner des Kommunismus mussten die Heimat verlassen und flüchten, um ihr Leben vor der kommunistischen Gewalt zu retten. Mehrere zehntausend slowenische Flüchtlinge verließen im Mai 1945 Slowenien, viele Domobranzen wurden aber mit einer Hinterlist gewaltsam nach Slowenien zurückgebracht. Sie wurden den Kommunisten ausgehändigt und ohne Gerichtsverfahren gemartert und ermordet, berichtet die Kirchenzeitung „Nedelja“.
Erstmals nahm auch Bischof Josef Marketz an dieser slowenischen Wallfahrt teil. In seiner Predigt sagte er u.a.: „An der Stelle, wo wir heute stehen, vernahm man das Weinen von Müttern, die Gebete der Alten und das Schweigen jener, die erahnten, dass ihr Weg zu Ende geht. Das waren unschuldige Menschen, die vor der Gewalt im Glauben und in der Hoffnung flüchteten, dass sie vom Westen gerettet werden. Anstatt dessen aber wurden viele in den Tod zurückgeschickt. (…) Unsere Aufgabe ist heute nicht die Rache, sondern die Wahrheitsliebe, ein würdiges Gedenken und die Friedensbereitschaft. Ihr Blut möge nicht nach Feindschaft, sondern nach Gerechtigkeit und Frieden rufen“.3
Es ist bemerkenswert, dass am Gedenken an die slowenischen Opfer der Tito-Partisanen nun auch Diözesanbischof Josef Marketz teilnimmt. Den Kärntner Opfern der Tito-Partisanen, an die ein Gedenkstein auf dem Domplatz in Klagenfurt erinnert, wird von der Kirche (angeblich) seit einiger Zeit ein christliches Gedenken vorenthalten.
– Ebenfalls am 29.5.2025 fand in der Gottschee im Wald am Fuße des Berges Macesnova gorica im Gottscheer Horn (Kočevski rog) ein Gedenken an die Partisanenopfer statt. Historiker gehen davon aus, dass im Gottscheer Horn an mehreren Grabstätten bis 30.000 Opfer ums Leben gekommen sind. Am 29.5.2025 fand eine Staatsfeier statt, an der auch die slowenische Präsidentin Nataša Pirc Musar teilgenommen hat. Die Staatspräsidentin erklärte am Rande der Gedenkfeier, dass ihr die Entscheidung, zu kommen und den Ermordeten die Ehre zu erweisen, nicht schwer gefallen sei, „weil dies aus der Perspektive zivilisierter Normen und Werte richtig ist. Ich will diese Werte nicht nur vertreten, sondern auch leben“. Sie wiederholte, dass man anerkennen müsse, dass es sich bei den Morden um Verbrechen gehandelt hatte. Die Versöhnung sei immer schwierig, sagte sie.
„Die Versöhnung ist nicht möglich, so lange das Verbrechen nicht als solches bezeichnet und verurteilt wird und so lange wir nicht klar sagen, dass die außergerichtlichen Massenmorde ein Verbrechen waren“, sagte Bischof Andrej Saje. Die Staatsfeier wurde vom Verteidigungsministerium ausgerichtet. Das sei eine Aufgabe des Staates. Verteidigungsminister Borut Sajovic legte einen Kranz nieder.4
Bei dieser Staatsfeier handelt es sich um ein separates staatliches Opfergedenken vor der am 7.6.2025 stattfindenden traditionellen Gedenkveranstaltung. Die (linke) slowenische Staatspräsidentin wollte damit ein gemeinsames Auftreten mit der „Nova Zaveza“, dem Traditionsverband der (katholischen, traditionell antikommunistischen) slowenischen Domobranci, ausweichen. 5 Vergleichbare, offizielle Opfergedenken gibt es in Kärnten nicht.
– Am 7.6.2025 fand in der Gottschee (Kočevski rog) die traditionelle Gedenkveranstaltung statt. Die Messe wurde wieder von Bischof Andrej Sale zelebriert. Demnach seien die Wunden des Krieges noch immer nicht verheilt. Dazu die Begründung des Bischofs: „Die Verbrechen der revolutionären Gewalt wurden bis heute nicht verurteilt, die unschuldigen Opfer wurden nicht von der Schuld reingewaschen und deren sterblichen Überreste wurden unverständlicherweise noch immer nicht beerdigt“.6
Die Katholiken Sloweniens sind um Versöhnung bemüht. So werden Kerzen beim Denkmal der Revolution auch für „Verbrecher“ angezündet. Auch diese mögen ihren Frieden finden. Für Opfer der revolutionären Gewalt, die auf Grund ihres Glaubens ermordet worden sind, wird allmonatlich eine Messe mit der Bitte um Selig- oder Heiligsprechung gefeiert. Dazu gehören 26 Personen, darunter auch der Kärntner Theologe Lambert Ehrlich. Aus der Aufzählung ist ersichtlich, dass die letzte Hinrichtung erst am 257.5.1950 erfolgt ist. Es betraf den Priester Matej Krof.7
2. Kärnten im Gedenkjahr 2025…
Das Kärntner Jahr der Erinnerungskultur 2025 wird ohne Vergebung und Versöhnung begangen. Die revolutionäre Gewalt wird in eine Widerstandsbewegung transformiert.
Während in Liescha/Leše ein schrecklicher Martertod von unbewaffneten Opfern beklagt wird, wird unter dem Deckmantel des nationalsozialistischen Widerstandes der Titoismus gepriesen.
– In diesem Sinne werden im Rahmen des Gedenkjahres 2025 beispielsweise Konzerte mit Kampfliedern des Partisanen und Dichters Karel Destovnik – Kajuh in Bleiburg, Laibach und Triest organisiert.8 Zur Person Karel Destovnik schreibt der Historiker Ivo Žajdela: „Karel Destovnik-Kajuh leitete eine sogenannte Suchgruppe beim VOS (=UDBA) in Laibach. Er kooperierte mit den berüchtigsten VOS-Mördern. Er sorgte dafür, dass diese möglichst viele Informationen über Menschen erhielten, die sie danach ermordeten.“ In den Nachkriegsjahren sei Kajuh von den UDBA-Leuten zu den bekanntesten Agenten gezählt worden, die im Jahre 1942 in Laibach im Rahmen „der kommunistischen terroristischen Organisation VOS“ die bekanntesten Menschen ermordeten. Die Kommunisten haben dem Karel Destovnik, einer Person, die sehr aktiv an den kommunistischen Verbrechen beteiligt war, nach dem Krieg viele Denkmäler, Namen von Gassen und Schulen und etc. gewidmet. Die Linken versuchten, Destovnik als Dichter und sogar als Humanisten zu würdigen, kritisiert der Historiker.9
Die Organisatoren und die politisch Verantwortlichen für das Kärntner Gedenkjahr 2025 nehmen auf die traumatisierten Partisanenopfer keinerlei Rücksicht. Nicht einmal ein Gedenkstein auf dem Domplatz in Klagenfurt sollte demnach an die Opfer der Tito-Partisanen erinnern.
Kärnten verhält sich diesbezüglich dem Grunde nach wie Slowenien vor der Demokratisierung 1991.
– Am 24.5.2025 fand beim Peršmanhof eine Gedenkfeier statt. Der Landespressedienst berichtet u.a.: Erinnerungsjahr: Gedenken und Kranzniederlegung am Peršmanhof bei Bad Eisenkappel mit Vizekanzler Babler, LH Kaiser und Sloweniens Staatssekretär Dejan Židan: Niemals vergessen und das Peršman-Museum sind Mahnung und lebendiger Widerstand gegen Radikalismen und Faschisten. Am Peršmanhof befindet sich heute ein Museum mit dem Inhalt der Geschichte und des Widerstandes der Kärntner Slowenen während des Nationalsozialismus. Der Društvo/Verein Peršman wurde 2001 (?) in Klagenfurt gegründet, um die Verdienste des kärntner-slowenischen Widerstandes gegen den Nationalsozialismus im öffentlichen Gedächtnis zu fördern. Der Verein positioniert sich gegen rechtsextreme und faschistische Tendenzen der Gegenwart und unterstützt den Betrieb des Museums und der Gedenkstätte Peršmanhof in Bad Eisenkappel/Železna Kapla.10
Der Gastgeber der Veranstaltung Bernard Sadovnik betonte, dass es nach 80 Jahren endlich an der Zeit sei, „dass der Widerstand der Kärntner Sloweninnen und Slowenen gegen das nazistische Regime endlich zur Gänze anerkannt wird und man die Lebens- und Leidensgeschichten der vertriebenen Kärntner Sloweninnen und Slowenen in Unterrichtsbehelfen aller österreichischen Schulen findet. Auch deshalb, damit wir klar sagen: die zahlreichen Opfer waren nicht umsonst. Diese Opfer leisteten einen Beitrag zur Befreiung, zur Demokratie, zum Frieden und zur Unterzeichnung des Österreichischen Staatsvertrages“.11
Dazu einige Fakten: Alle 4 Söhne des Perschmannhofes waren bei der deutschen Wehrmacht.
Die „Befreiung“ im Jahre 1945 wird von renommierten Historikern relativiert: „Demnach hat es im Jahre 1945 eine wirkliche Befreiung Sloweniens nicht gegeben, weil die Befreiung aus dem Kerker des totalitären Regimes der Okkupanten nur in eine neue Versklavung durch ein anderes totalitäres Regime – die Herrschaft der Kommunisten – mündete. Befreit – und somit frei – ist Slowenien erst seit dem 25. 6.1991“.12 Man beachte dazu Janko Krištof, Pfarrer in Ludmannsdorf: „Es ist entsetzlich wie noch heute bei Partisanenfeiern gesprochen wird und wie wenig die begangenen Verbrechen bedauert werden“.13 Dechant Janko Krištof macht auch darauf aufmerksam, dass es zu diesem Thema bereits eine Menge Literatur gibt: „Wie viel Literatur ist dazu schon erschienen und wie viele Berichte über Gräueltaten können wir über all das lesen! Ich bin mir dessen bewusst, dass wir Kärntner nur schwer verstehen können, was in der Kriegszeit in Slowenien passiert ist, weil wir bei uns nazistische Scharfrichter hatten, die uns bedroht und verfolgt haben. In vielen Orten in Slowenien, insbesondere unter italienischer Okkupation, aber haben im Namen der Revolution die Partisanen bzw. ihr Geheimdienst VOS dies und noch Schlimmeres verübt. (…) Wie gesagt, in Slowenien sind in diesen Jahren unzählige Bücher veröffentlicht worden. Es würde niemandem schaden, davon etwas zu lesen. (…) Unsere Zerrissenheit hat niemand anderer als die Kommunisten verursacht. Die Kommunisten haben unser Volk in eine große Tragödie gestoßen und noch heute sind sie nicht in der Lage, dies einzusehen und zu bereuen. Gott sei Dank ist ihre Schreckensherrschaft zu Ende. Unser gemeinsames Bemühen soll sein, dass die Wunden aus dieser Zeit heilen und wir uns um eine Versöhnung bemühen und zum Wohle des gesamten Volkes arbeiten.“14 Diese Bedenken zur Befreiung treffen bekanntlich bis 20.5.1945 auch für Südkärnten zu. Die Verschleppten sind ein Beweis dafür.
Die Veranstaltung beim Peršman-Museum ist symptomatisch für die Ausrichtung der Gedenkstrategie 2025. Es ist bemerkenswert, dass nicht alle Landesparteien und nur bestimmte Landespolitiker regelmäßig anwesend sind.
– Am 7.6.2025 fand am Loiblpass am Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Loibl-Nord eine internationale Gedenkveranstaltung statt. Durch diese wiederkehrende Veranstaltung soll das lange Zeit vergessene Außenlager von Mauthausen ins Gedächtnis der Bevölkerung gerufen werden. LH Peter Kaiser warnte vor Strömungen, die demokratische Grundwerte, die Menschlichkeit und länderübergreifende Zusammenhalt in Frage stellen.
Das Mauthausen Komitee wurde 1995 von engagierten Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen der Universität Klagenfurt unter der Leitung von Prof. Peter Gstettner ins Leben gerufen.15 Dieses Engagement ist grundsätzlich zu würdigen. Wir sollten nämlich nicht vergessen, dass auch (demokratische) Österreicher in der Vergangenheit Verbrechen verheimlicht haben. Das KZ-Lager auf dem Loibl haben wir einfach weggelassen. Dort sind Antifaschisten beim Bau unseres Tunnels ums Leben gekommen. Kärntner Antifaschisten haben dieses Verbrechen in unsere Erinnerungskultur zurückgeholt. Das ist deren positive Seite.
Sie haben aber weggelassen, dass durch eben diesen Tunnel unmittelbar nach der Befreiung des Mauthausen Außenlagers Anti-Kommunisten vor den slowenischen Anti-Faschisten nach Kärnten geflüchtet und viele tausende davon in weiterer Folge ums Leben gekommen sind. Slowenische (titoistische) Anti-Faschisten errichteten unmittelbar nach dem Krieg in Slowenien Konzentrationslager für (katholische…) Anti-Kommunisten. In Slowenien wurde also ein totalitäres System durch ein anderes ersetzt, berichten slowenische Fachexperten. Das (stalinistische) totalitäre System konnte bis zum 20.5.1945 auch in Südkärnten mit Verschleppungen und Ermordungen beginnen. Diese dunkle Seite lassen die heutigen antifaschistischen Ideologen weg und setzen somit die überholte Tradition der Tito-Partisanen im Kärntner Gedenkjahr 2025 fort. Das Verbotsgesetz schützt uns einigermaßen vor der Geschichtsauffassung der Rechten und einer nationalsozialistischen Wiederbetätigung. Vor einer titoistischen Wiederbetätigung müsste sich die Kärntner Zivilgesellschaft selbst schützen.16
– „Es ist an der Zeit, die ganze Geschichte in den Blick zu nehmen“, wird von der Initiative Domplatz mit Unterstützung des Landesmuseums und somit des Landes Kärnten im Zusammenhang mit dem Verschlepptendenkmal auf dem Domplatz eingefordert. In einer Reproduktion des Originaldenkmals auf dem Domplatz wurden die Worte „von Partisanen“ herausgeschnitten. Aus dem Text „Im Gedenken an die (…) von Partisanen verschleppten und ermordeten…“ wird „Im Gedenken an die (…) verschleppten und ermordeten…“. Dieser „neue“ Gedenkstein steht nun vor dem Landesmuseum. Das herausgeschnittene Stück „von Partisanen“ wird in der offiziellen Ausstellung „Hinschaun/Poglejmo“ im Landesmuseum zur Schau gestellt. Der Hinweis auf die unstrittige Täterschaft der Tito-Partisanen wurde somit offensichtlich auf Kosten des Landes entfernt. Die Täter werden verheimlicht.
Im Standardwerk „Slowenische Geschichte“, zu den Herausgebern gehört auch der Präsident der Slowenischen Akademie der Wissenschaften und Künste Peter Štih wird festgehalten: „Der kommunistischen Führung gelang es, die Massenhinrichtungen in hohem Maße zu verheimlichen“.17
Jeder Hinweis auf die Partisanen als Täter war streng verboten und wurde nicht selten mit dem Tod bestraft. Im Kärntner Gedenkjahr 2025 wird diese Verheimlichung fortgesetzt und Wahrheitssuchende werden diffamiert. Es ist von einer politischen Verantwortung auszugehen (culpa in eligendo).
– Mit der Ausstellungseröffnung am 9.5.2025 „Hinschaun/Poglejmo“ wurde das Gedenkjahr 2025 gestartet. Der zuständige Historiker Peter Pirker präsentierte bereits am 25.4.2025 im Landesmuseum seine neuesten Erkenntnisse zum Perschmann-Massaker. Unter dem Titel „Es ist eine Lüge, dass das Massaker nicht aufgeklärt ist“, berichtet darüber auch die slowenische Zeitung „Novice“. Demnach habe Pirker den ungarischen Strafprozess gegen Sandor Marton vorgestellt. Er sagte „Amalija Sadovnik, die einzige Zeugin des Schusswechsels vor dem Haus, hat den Haupttäter, welcher auch sie verletzt hatte, als einen jungen, klein gewachsenen Mann mit starker Statur beschrieben“. Dieser Beschreibung entsprach der ungarische Staatsbürger Sandor Marton anlässlich des Massakers beim Peršman 17 Jahre alt. (Aus dieser Beschreibung wird also auf die Täterschaft geschlossen!) Das Massaker beim Peršman habe laut Pirker daher einen gerichtlichen Epilog gehabt, „im Sinne der gesellschaftlichen Auswirkung war es aber fatal, dass die österreichische Öffentlichkeit vom Resultat des Prozesses nichts erfuhr. Somit konnten sich Mythen und Lügen verwurzeln, die immer wieder erzählt werden, wonach das Massaker nicht aufgeklärt ist und die Täter ungestraft sind“.18
Dazu ein erster Faktencheck: Den in ungarischer Sprache präsentierten Dokumenten ist aus juristischer Perspektive überhaupt nicht zu entnehmen, dass dem 17-jährigen Ungarn Sandor die Ermordung der Familie angelastet worden ist. Der Direktor des Landesmuseums wurde daher gebeten, die Einsichtnahme in die vorliegenden ungarischen Dokumente zu ermöglichen. Die Bitte wurde abgelehnt.
In der Ausstellung wird auch das Schreiben der Sicherheitsdirektion für Kärnten vom 2.9.1946, gerichtet an das Bundesministerium für Inneres präsentiert. Im Schreiben wird aus logischen, verfahrensrechtlichen Erwägungen zunächst behauptet, dass „die Verantwortung des Lt. Reischl für diese Tat einwandfrei klargestellt“ wurde. Davon musste man zunächst natürlich ausgehen, um die Ausforschung und Auslieferung des Verdächtigen zu erreichen. Danach musste das Verfahren gegen Lt. Josef Reischl aber am 19.8.1948 nach einer sehr langen Untersuchungshaft eingestellt werden. Diese Einstellung des Verfahrens sei gesetzlich begründet gewesen, wird sogar im Buch „Peršman“ berichtet.19 In der Ausstellung wird diese Einstellung verschwiegen und somit Reischls (vorläufige) Verantwortung für die Tat als Faktum hingestellt.
Die sensationelle Auffindung der gerichtlichen Unterlagen durch den wissenschaftlichen Leiter des Erinnerungsjahres 2025 ist ebenfalls nicht nachvollziehbar. Bereits vor Jahrzehnten wurde in der Partisanenliteratur darüber berichtet. Es ist davon auszugehen, dass auch im Archiv des Partisanenverbandes diesbezügliches Material zu finden wäre und sprachkundige Historiker Überraschendes finden würden.
Den interessierten Leser verweise ich vorerst auf den Artikel „Das Kärntner Jahr der Erinnerungskultur 2025 – Eine kritische Vorschau“ (von Josef Lausegger) in der Carinthia I 2024, S. 725 ff. Im Abschnitt „Die Initiative Domplatz und der Verein Peršman“ (S. 749 ff) wird bereits eingehend auf das Thema Perschmann eingegangen und festgestellt, dass das Massaker nicht aufgeklärt ist. Zu diesem Ergebnis kommt auch der renommierte und bestens informierte Historiker Marjan Linasi: „Auf jeden Fall geht es hier um komplizierte Fragen, die nach einem so langen Zeitraum nicht mehr ausreichend rekonstruierbar erscheinen, zumal dies nicht einmal in der Untersuchung nach dem Krieg möglich war“.20 Entgegen der Meinungsbildung des für das Gedenkjahr 2025 engagierten Historikers Peter Pirker gibt es Fakten, wonach das Massaker nicht aufgeklärt worden ist. Konkrete Beweise dafür gibt es in der Publikation „Peršmanhof 1945“ des Historikers Wilhelm Baum. Marjan Linasi nimmt auf diese Quellen ausdrücklich Bezug.21 Baum geht in seinem Buch auch auf das Interview mit dem Zeitzeugen Anton Pečnik-Tine ein, der berichtete, dass die Partisanen die Tat verübt hätten. Die Erkenntnisse des Historikers Baum werden im Gedenkjahr 2025 ignoriert.
Es wäre höchste Zeit, für diese strittige und die Menschen vor Ort noch immer belastende Frage eine neutrale Wahrheits- und Versöhnungskommission einzusetzen. Das Museum-Peršman sollte nicht Kampfbereitschaft (siehe: Denkmal), sondern Wahrheit und Versöhnung ausstrahlen. Es müsste zu einem Friedensmuseum werden.
– Der in der Carinthia I 2024 veröffentlichte Artikel (s.o.) führte zur Verunsicherung der Strategen des Gedenkjahres 2025. Es werden geheim Unterschriftenlisten gesammelt und gegen den Artikel heftig protestiert. Nicht nur der Autor soll damit eingeschüchtert werden. Diese politische Druckausübung sollte in einer demokratischen Gesellschaft nicht mehr üblich sein.
Nachrichtendienste gehen von einem neuen Kalten Krieg aus. Die belastende Kärntner Geschichte ist besonders geeignet, mit Provokationen dazu beizutragen. Geheimdienstliche Gruppen aus den 1970er Jahren, als Kärnten am Rand eines Bürgerkrieges stand, sind wieder aktiver geworden.
Das Kärntner Gedenkjahr 2025 wird in die Geschichte eingehen.
1 KZ, 2.6.2025, S. 13; Krone, 30.5.2025, S. 22.
2 Othmar Mory, Liescha/Leše – 1945. Stätte des Grauens und des Gedenkens, 2002, S. 137 ff, 153,
3 Nedelja, 1.6.2025, S. 7; Red.: Mateja Rihter.
4 https://www.rtvslo.si/80-let-od-konca-2-svetovne-vojne/predsednica-republike-se-je-poklonila-zrt…, 29.5.2025.
5 Nedelja, 8.6.2025, S. 2; Red.: Aleš Maver.
6 https://www.rtvslo.si/80-let-od-konca-2-svetovne-vojne/saje-ob-80-obletnici-pobojev-zrt…, 7.6.2025.
7 Domovina, 29.5.2025, S. 3, 17 ff, 20, 21.
8 Novice, 9.5.2025, S. 20; Partisanen-Lieder 17.5.2025 in Bleiburg, 25.5.2025 in Laibach und 7.6.2025 in Triest. Quelle: https://www.erinnerungskultur2025.at/impressum/, Abruf: 25.3.2025; Medieninhaber: Kärntner Bildungswerk, Kontakt: Gerti Malle.
9 Reporter, 27.2.2023, S. 54 ff., 6.3.2023, S. 48 ff.
10 https://www.ktn.gv.at/Service/News?nid=38379, Abruf: 26.6.2025.
11 Novice, 30.5.2025, S. 3.
12 Tamara Griesser-Pečar, das zerrissene Volk Slowenien 1941-1946, 2003, S. XII, 515.
13 Quelle: Demokracija, 27.8.2020, S. 8.
14 Novice, 17.11.2017, S. 2.
15 https://www.ktn.gv.at/Service/News?nid=38426
16 Die Kollaboration mit dem Bolschewismus sei eine Besonderheit Sloweniens, meint der Autor Justin Stanovnik. Das bedeute, dass die Slowenen gleichzeitig Opfer zweier Aggressionen waren: nicht nur der faschistischen und nazistischen, sondern auch der kommunistisch-bolschewistischen. Man sei einem doppelten Stoß ausgesetzt gewesen. Quelle: Justin Stanovnik, Kolaboracija z boljševizmom – posebnost Slovenije, in: Zaveza, Nr. 136, Juni 2025, Ljubljana, S. 91, ff.
Diese schlimme Situation gab es auch in Südkärnten vor dem Abzug der Tito-Partisanen am 20.5.1945!
17 Peter Štih, Vasko Simoneti, Peter Vodopivec, Slowenische Geschichte, 2008, S. 387.
18 Novice, 2.5.2025, S. 6. Red.: TV
19 Peršman, herausgegeben von Lisa Rettl, Gudrun Blohberger, Zveza koroških partizanov/Verband der Kärntner Partisanen, Društvo/Verein Peršman, Wallstein Verlag 2014, S. 79 ff.
20 Marjan Linasi, Die Kärntner Partisanen, Hermagoras Verlag 2013, S. 224-232.
21 Marjan Linasi, Die Kärntner Partisanen, S. 227.