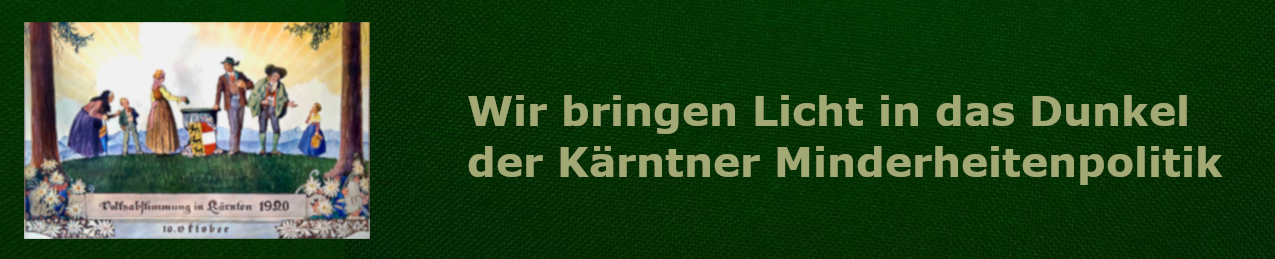Lau-Info. 89
24.9.2025 Revisionismus – Im kärnten-museum findet eine Diskussion zur Ausstellung „Hinschaun/Poglejmo“ statt. Teilnehmer: Elisabeth Klatzer, Andreas Mölzer, Peter Pirker, Klaus Schönberger, Marjan Sturm, Wilhelm Wadl und ein Statement von zweintopf.1
Prof. Klaus Schönberger (AAU) kritisierte den Beitrag in der Carinthia I 2024 des Autors Josef Lausegger unter dem Titel „Das Kärntner Jahr der Erinnerungskultur2025 – Eine kritische Vorschau“. Das sei ein „geschichtsrevionistischer“ Beitrag, so der deutsche Volkskundler Schönberger. Auch darüber hinaus verhielt sich der Deutsche eher ungezügelt (strastno), womit er zur Gesprächskultur nicht unbedingt einen Beitrag leistete.2 In der slowenischen Wochenzeitung Novice wird nicht zu Unrecht berichtet, dass Schönberger als einziger der Diskussionsrunde einen negativen Einfluss auf das Gesprächsklima ausgeübt hat.3 Prof. Schönberger wurde von anwesenden Antifa-Leuten unterstützt.
Die Kulturwissenschaftlerin Elena Messner weiß zu berichten, dass in einem offenen Brief, den 90 Wissenschaftler:innen an den Kärntner Geschichtsverein richteten, Lauseggers „Manipulationen“ und „Geschichtslügen“ kritisiert und zurückgewiesen wurden.4 Eine konkrete Begründung fehlt. Der „offene Brief“ wurde geheim gehalten. Zu den Unterzeichnern des „offenen Briefes“ gehören alle vom Museum nominierten Diskussionsteilnehmer: Elisabeth Klatzer (Initiatorin des Protestschreibens), Zweintopf (Eva und Gerhard Pichler), Peter Pirker (verantwortlich für die Ausstellung „Hinschaun/Poglejmo) und Klaus Schönberger (Landesbeauftragter für das Gedenkjahr 2025 und Aktivist gegen das bestehende Abwehrkämpferdenkmal auf dem Domplatz).
Im kritisierten Carinthia-Beitrag von Josef Lausegger wird gegen die ideologische Ausrichtung des Kärntner Gedenkjahres 2025 verstoßen. Die Partisanen werden nämlich nicht nur in einem positiven Licht dargestellt. Es werden auch die dunklen Seiten dieser Tito-kommunistischen Geschichte beleuchtet. Nicht zuletzt im Sinne der bekannten Entschließungen des Europäischen Parlaments wird auch das Massaker-Perschmann möglichst objektiv und ohne ideologische Hintergedanken thematisiert. Nach der titoistischen Geschichtsschreibung wurden abweichende Geschichtsauffassungen als „Revision“ gebrandmarkt und streng bestraft. Unmittelbar nach dem Krieg sogar mit dem Tod. Anton Sadovnik (vlg. Peternel), ein Perschmann-Sohn, dürfte von den Partisanen im Jahre 1946 auch wegen seiner Thematisierung des Perschmann-Massakers liquidiert worden sein. Sein Bruder Franz (Vater des Politikers Bernard Sadovnik) wurde zu Kriegsende ebenfalls bedroht.
– Eine Ablehnung oder gar ein Verbot der „Revision“ der (überholten) Partisanengeschichte, wie von Prof. Klaus Schönberger (AAU Klagenfurt) erwartet, ist in demokratischen Gesellschaften aber nicht mehr tolerierbar:
Die Slowenische Akademie der Wissenschaften und Künste erwartet sogar dezidiert eine Revision dieser Geschichtsschreibung. In der offiziellen Erklärung der Slowenischen Akademie der Wissenschaften und Künste (SAZU) vom 22. und 25.2.2021 heißt es u.a.: Mehrere Jahrzehnte lang wurde die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg von der schwarz-weißen Erzählung über einen Befreiungskampf auf der einen und den Verrätern auf der anderen Seite bestimmt. Für Verbrechen, verursacht im Namen des Befreiungskampfes gab es keinen Platz. Nicht einmal für den Missbrauch des Befreiungskampfes seitens der kommunistischen Führung zwecks Herstellung und Sicherung der eigenen Herrschaft gab es Platz. Mit der Demokratisierung der slowenischen Gesellschaft wurde eine Revision einer solch einseitigen Erzählung (Narrativ), die ideologisch und nicht historisch begründet ist, notwendig. (…) Ein mit der Vergangenheit unbelastetes gesellschaftliches Miteinander kann nur mit der Suche nach der Wahrheit über die Ereignisse in der Kriegszeit und danach erreicht werden. Diese Ereignisse müssen auf der Grundlage allgemeiner ethischer Grundsätze sowie mit pietätvollen Gedenkhandlungen, die für alle Gefallenen, Getöteten und Ermordeten bestimmt sind, bewertet werden. Soweit nur möglich, müssen wir das Unrecht gut machen, mit den gegenseitigen Beschuldigungen, den Ausgrenzungen sowie der Instrumentalisierung der Geschichte aufhören und bei all dem die Andersdenkenden achten“.5
Auch seitens renommierter linker Historiker wird eine Revision der überholten Geschichtsschreibung thematisiert. Der linke Historiker Eric J. Hobsbawm, der von Historikern gerne zitiert wird, hat zum Thema Revision eine ausgewogene Position. Der Aufstieg des Rechtsextremismus in seinen verschiedenen Formen sei eng mit dem so genannten „Revisionismus“ in der Geschichtsschreibung verbunden. Mindestens seit Mitte der achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts lebten die Forscher der Zeitgeschichte in ständigem Historikerstreit. Hobsbawm wörtlich: „ Aber das stellt uns auch als linke Historiker vor ein ernstes Problem. Denn wir müssen offen zugeben, dass eine Revision der Geschichte für die Zeit des Faschismus nötigist, schon weil so viel über diese Epoche aus politischen und anderen Gründen verschwiegen und anderes verzerrt wird. Ein Teil – wer weiß, wie viel vom Geschichtsbild meiner Generation – besteht aus einer Mythologie der Sieger im Zweiten Weltkrieg, verzerrt im Kalten Krieg durch Gleichsetzung von Faschismus und Kommunismus. Wer z.B. auch im eigenen Land, sprach von den Deutschen als Opfer und nicht als Täter, bevor Günter Grass den Mut dazu hatte? Bloß ein paar Rechtsextremisten. Aber es war richtig. Es gibt Dinge, über die man im letzten halben Jahrhundert nicht reden wollte oder konnte und trotzdem da waren. (…) Unsere Aufgabe ist es, auch über die verschwiegenen Dinge zu schreiben, die unangenehmen, die nicht in unser Konzept passen“.6
Die im Kärntner Gedenkjahr 2025 vom Land Kärnten eingesetzten Historikerinnen und Historiker und fachfremde Akteure wie Prof. Schönberger befürworten die dringend notwendige Revision der titoistischen Geschichtsschreibung nicht. „Die verschwiegenen Dinge“ passten nicht in das Konzept des Gedenkjahres 2025. Ohne Wahrheit kann es aber keine nachhaltige Versöhnung und somit keine Friedensregion Alpen-Adria geben. Dies gilt insbesondere für das Massaker Perschmann, das im Rahmen der Landes-Ausstellung „Hinschaun/Poglejmo“ keinesfalls aufgeklärt werden konnte.
Der Autor Josef Lausegger will sich in diesem Sinne daher weiterhin geschichtsrevisionistisch engagieren.
– Ein mit dem Perschmann-Narrativ vergleichbarer Disput findet in Slowenien betreffend die Dražgoše-Schlacht (9.1.1942 bis 11.1.1942) statt. Das sei ein Mythos, den man sich in der Zeit des Genossen Tito ausgedacht hat, argumentiert der Historiker und RTV-Fernsehmoderator Jože Možina. Diesen Mythos lassen sie sich nicht nehmen und greifen jeden an, der dagegen auftritt. Možina wörtlich: „Ich habe den Eindruck bekommen, dass sie vor der Wahrheit und vor Leuten, die glaubwürdig die Wahrheit vertreten, Angst haben“.7 Dem Autor Možina werden (ebenfalls) Geschichtsfälschung und Lügen zum Vorwurf gemacht. Eine grobe Beleidigung des Historiker Možina stand bei der Veranstaltung des Partisanenverbandes Velenje in Graška Gora im September 2025 auf der Tagesordnung. Ein Gerichtsverfahren wurde bereits eingeleitet.
Wegen der feindseligen Agitation gegen den Historiker Možina ist der Organisator dieses Partisanentreffens zurückgetreten und hat sein Bedauern zum Ausdruck gebracht.8
Auch in Kärnten gibt es Hinweise, dass eine Revision der Partisanengeschichte nicht mehr aufgehalten werden wird. Es mehren sich die Stimmen, die der Ansicht ebenfalls keinen Glauben schenken, dass das Perschmann-Massaker im Rahmen der Ausstellung „Hinschaun/Poglejmo“ aufgeklärt sei.
Es werden hoffentlich weitere „geschichtsrevisionistische“ Beiträge von verschiedenen Autoren, nicht nur zum Perschmann-Massaker, publiziert werden.
1 Begleitprogramm Sept-Okt-FINAL.pdf, Abruf: 10.9.2025.
2 Siehe T. Verdev, Omizje kot strasten političen miting, in: Novice, 3.10..2025, S. 5.
3 Vgl.: Leserbrief von Valentin Sima, Novice, 17.10.2025, S. 7.
4 Elena Messner, Mein Staatsvertrag, in: Stimme, Nr. 135, Sommer 2025, S. 11-13.
5 https://www.sazu.si/events/604f373d12416e9924e4eac7, Abruf: 25.7.2023
6 Eric J. Hobsbawm, „Herbert Steiner, Gründer und erster Leiter des DÖW, und die Bedeutung von Widerstandsforschung“, in: Jahrbuch 2004, Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, S. 16 ff.
7 Demokracija, 2.10.2025, S. 27 ff.
8 https://www.domovina.je/zaradi-sovraznega-govora-zopet-novinarj…, 23.9.2025.